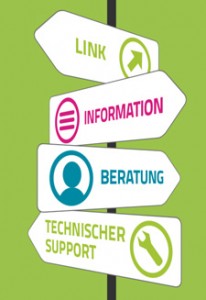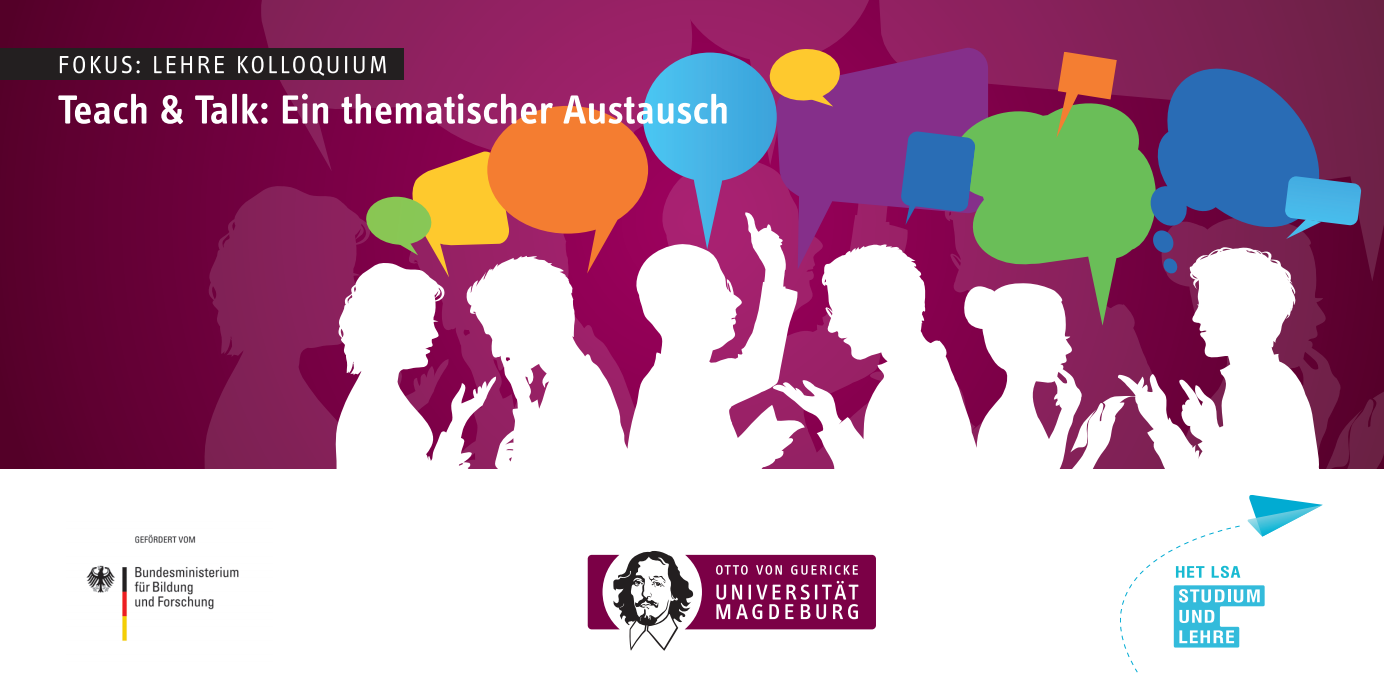Seit der Bologna Reform wird an Hochschulen zunehmend über Kompetenzorientierung diskutiert – aber worum geht es eigentlich beim Kompetenzbegriff?

Weinert hat eine vielzitierte Version des Kompetenzbegriffs auf folgender Weise zusammengefasst: „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27 f.).
Nun ist die Kompetenzdiskussion keine neue und Gabi Reinmann stellt sich verständlicherweise die Frage „[…] ob wir uns nicht auch verstehen würden, wenn wir von Wissen, Können und Haltungen sprechen würden, meinetwegen auch von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen.“ (Zitat aus dem Blogbeitrag vom 07.06.2011)
Bezogen auf Hochschulen führt laut Reis und Ruschin (2007) die Kompetenzorientierung in der Modulplanung zwangsläufig zu einer Didaktisierung des Lehrens, Lernens und Prüfens. Eine kompetenzorientierte Gestaltung von Studiengängen und Lehre umfasst laut Scharper et. al (2012) folgende Aspekte, welche sich an den Leitfragen orientieren (Scharper o.J.).
- Studiengangsentwicklung und Bestimmung des Kompetenzprofils
Was soll eine Absolventin/ein Absolvent am Ende des Studiums können bzw. in der Lage sein zu leisten?
- Kompetenzorientierte Lehr-/Lerngestaltung
Wie muss eine kompetenzorientierte Lehr- und Lernerfahrung gestaltet werden, um in authentische Aufgaben und Anforderungen einzubeziehen? Was soll der Lernende nach der Lerneinheit in der Lage sein zu tun bzw. zu können?
- Kompetenzorientierte Prüfungen
Wie muss kompetenzorientiertes Prüfen gestaltet werden, damit es den Inhalten und Anforderungsniveaus der Lernziele entspricht? Wie müssen Prüfungsformen und –prozesse gestaltet werden, um den Kriterien der Kompetenzorientierung und den Anforderungsniveaus der Lernziele zu entsprechen?
- Studienbegleitende Förderung der Studierenden
Welche Anforderungen auf die Studierfähigkeit ergeben sich durch den Erwerb anspruchsvoller fachbezogener und fachübergreifender Kompetenzen? Welche studiumsbegleitende Maßnahmen müssen angeboten werden, um der Mehrzahl der Studierenden einen Studienerfolg zu ermöglichen?
- Kompetenzorientierte Evaluation
Wie müssen Evaluationskriterien gestaltet sein, die sich auf die Bildungs- und Qualifikationsziele des Studiengangs, des Moduls oder der Lehreinheit beziehen? Welche alternative Erhebungsmethoden (z.B. Selbsteinschätzungsverfahren) erweisen sich als hilfreich für kompetenzorientierte Veranstaltungs- und Modulevaluationen?
- Qualifizierungsangebote für Lehrende
Wie müssen Qualifizierungsangebote für Lehrende gestaltet werden, um die Kompetenzorientierung in Studium und Lehre motivierend einzuführen?
Um den kollegialen Austausch zur Kompetenzorientierung in allen Facetten zu unterstützen, lädt das Zentrum für multimediales Lehren und Lernen am 15. Mai 2014 um 17.00 Uhr zu einer Veranstaltung der Reihe Open@LLZ ein. Unser Gast, Frau Dr. Claudia Bade von der Universität Leipzig, wird in ihrem Vortrag „Auf dem Weg zum kompetenzorientierten Prüfen. Impulse zu hochschuldidaktischen Veränderungen“ speziell auf den Begriff eingehen und erläutern, was eigentlich kompetenzorientiert ist und wie man gegenwärtig kompetenzorientiert lehren und prüfen kann.
Dr. Claudia Bade vertritt seit Oktober 2012 die Professur für Kompetenzentwicklung und Lebenslanges Lernen an der Universität Leipzig. Dr. Bade war seit 2000 in verschiedenen Positionen im deutschen und französischen Bildungswesen (in schulischen, universitären und außerschulischen Einrichtungen) sowie als Projektmanagerin für ein Sozialunternehmen in Europa und Asien tätig.
Weitere Informationen zum 4. OPEN@LLZ
Quellen:
Reinmann, Gabi (2011): Verständigung auch ohne den Kompetenzbegriff?. Ein Blogbeitrag vom 07.06.2011. Online erreichbar unter: http://gabi-reinmann.de/?p=2740. (23.04.2014).
Reis, Oliver & Ruschin, Sylvia (2007): Kompetenzorientiertes Prüfen als zentrales Element gelungener Modularisierung . IN: Kompetenzentwicklung an Hochschulen. Journal Hochschuldidaktik. Hochschuldidaktisches Zentrum der Universität Dortmund. 18. Jg. Nr. 2. 6 -9. Online erreichbar unter: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/ag2_referenztext_kompetenzorientiertes_pruefen.pdf. (23.04.2014).
Scharper, Niclas & Schlömer, Tobias & Paechter, Manuela (2012): Kompetenzen, Kompetenzorientierung und Employability in der Hochschule. Zeitschrift für Hochschulentwicklung. ZFHE. 7 Jg/Nr. 4. Online erreichbar unter: http://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/525 (23.04.2014).
Scharper, Nicklas (o.J.): Kompetenzorientiertes Lernen im Studium – Wo muss man ansetzen, um Kompetenzen wirkungsvoll zu fördern? Vortrag an der Universität Paderborn. Online erreichbar unter: http://www.hrk-nexus.de/uploads/media/Schaper_Kompetenzorientiertes_Lernen_im_Studium.pdf. (23.04.2014).
Weinert, E. Franz (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen. Weinheim und Basel: 2001: 27f.