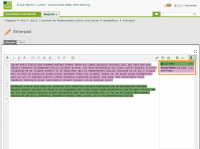Über das Wort „E-Learning“ kann man immer gut streiten. Denn als schillernder Begriff subsumiert er ganz verschiedene inhaltliche Konzepte, Ziele oder auch Interessen, nicht nur an Hochschulen. Die begriffliche Unbestimmtheit ist sicherlich gut aus der historischen Entwicklung zu erklären, beruht aber vielleicht auch zum Teil auf einem Mix aus Bequemlichkeit und Erklärungsnot.
Denn es ist natürlich einfacher, ganz allgemein von „E-Learning“ zu sprechen als nach Anreicherungs- und Virtualisierungskonzept bzw. Blended Learning zu unterschieden und dies in allen Texten und bei allen Präsentationen jedes Mal näher zu erläutern. Oder inhaltlich korrekt zwischen Lehren und Lernen zu differenzieren, wo doch E-Learning streng genommen nur die eine Seite der Medaille bezeichnet und von E-Teaching ergänzt wird.
Dieses Dilemma zwischen begrifflicher Unschärfe und ständigem Erläuterungsbedarf ist den (oftmals auch noch so bezeichneten) „E-Learning-Zentren“ oder „E-Learning-Services“ an den Hochschulen durchaus bewusst. Das Ausweichen auf Alternativbegriffe wie „multimediales Lehren und Lernen“ trifft es allerdings auch nicht genau, denn damit entfällt a) die Perspektive des Virtualisierungsgrades, b) muss Online-Lernen (und selbstverständlich auch –Lehren) nicht zwangsläufig (nur) multimedial daherkommen, vor allem aber ist c) dieser Begriff so sperrig, dass er Layouter regelmäßig zum Augenrollen verleitet.
Bleibt der Kompromiss „Blended Learning“? Abgesehen von der wiederum einseitigen Learner-Perspektive ist er zwar hervorragend kurz genug und bezeichnet zudem ein Veranstaltungskonzept, das die meisten Präsenzhochschulen guten Gewissens auch anstreben können, aber der Begriff ist bei den meisten Lehrenden mindestens ebenso erklärungsbedürftig wie „Massive Open Online Course“ oder „Flipped Classroom“.
Für die Verfechter der deutschen Sprachpflege bietet sich noch „computergestütztes Lernen“ an, mit dem manche aber eher Röhrenmonitore und 5,25-Zoll-Disketten assoziieren.
Ja, eigentlich sollten wir uns vom notgedrungenen Universalbegriff „E-Learning“ verabschieden und je nach Kontext präzisere Wörter verwenden. Mit dem Dilemma der exakten Sprache, dass sie nur mit Vorwissen verstanden werden kann, wäre dann zu leben. Und mit den zwangsläufig damit verbundenen, wieder anderen Missverständnissen auch.