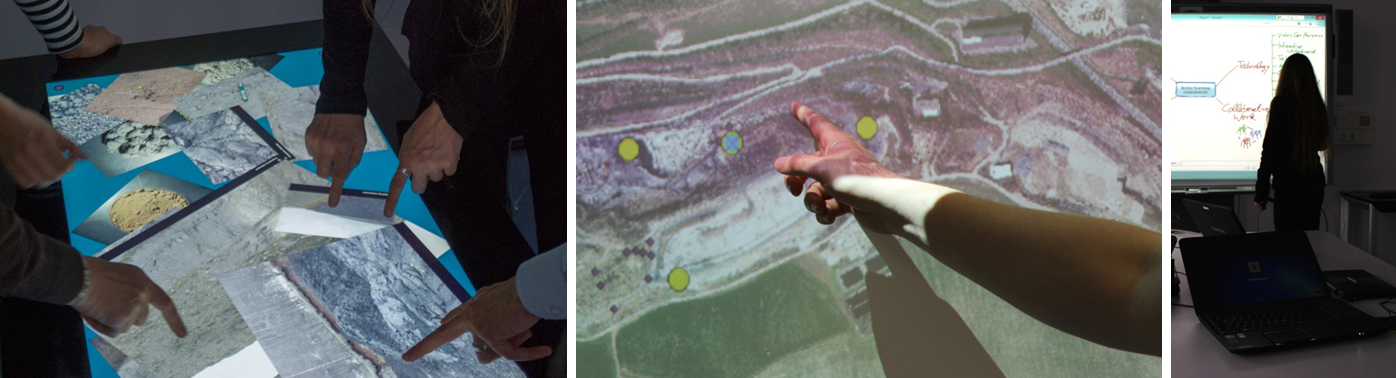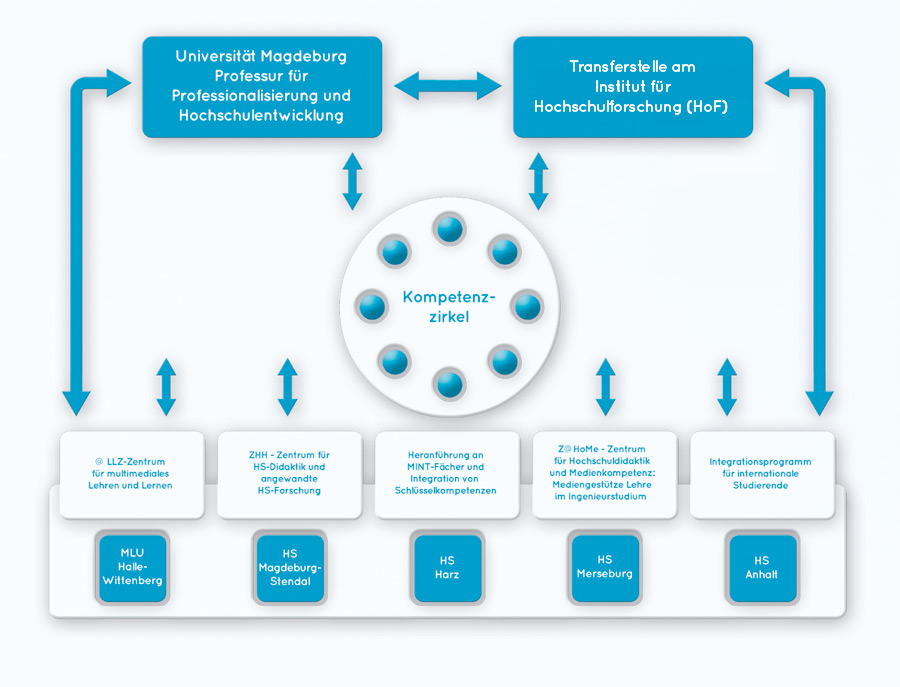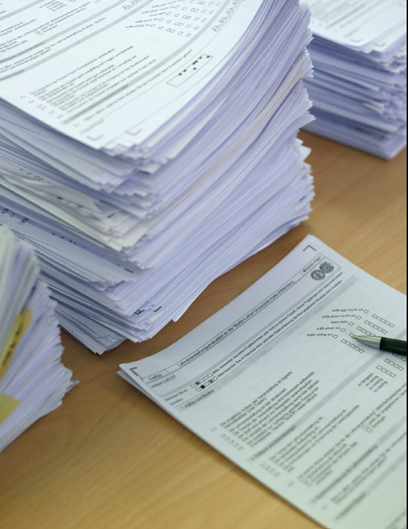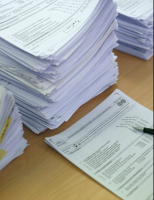Das @LLZ hat in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und dem ITZ Uni Halle, das von der THM unter Leitung von Prof. Klaus Quibeldey-Cirkel als HTML5-App entwickelte „ARSnova“, auf unseren Servern an der Uni Halle mit eigener Authentifizierung als freien kostenlosen Online-Service implementiert und uniinterne Anpassungen des Systems vorgenommen. Damit steht insbesondere Lehrenden und Studierenden der Martin-Luther-Universität eine einfache Nutzerregistrierung über den Universitäts-Account zur Verfügung. Darüber hinaus wurde auch eine Registrierung für alle Verbundhochschulen des Landes Sachsen-Anhalt (Verbund HET LSA) über den Hochschul-Account eingebunden. Alternativ zur Registrierung über den Hochschul-Account besteht die Möglichkeit das System als Gast, also als unregistrierter Nutzer (mit Einschränkungen), zu verwenden. Abrufbar ist ARSnova über https://arsnova.uni-halle.de in den Browsern Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 22+ und Opera 12+. Für Lehrende der Uni Halle ist zudem zeitnah eine Stud.IP-Anbindung geplant, die es ermöglicht, dass Lehrende eine ARSnova-Session direkt an den gewünschten Kurs anbinden können. Ein Vorteil ist, dass dann ein Austausch der Session-ID mit den Kursteilnehmern entfällt.
Der Einsatz von ARSnova bedarf Vorbereitung. Technisch sollte ein WLAN-Netz verfügbar sein, mindestens aber die Möglichkeit ein Mobilfunknetz zu nutzen. Obwohl der überwiegende Teil an Hörsälen und Seminarräumen mit einem Internetzugang (WLAN-Access-Points) ausgestattet ist, bitten wir Lehrende der Uni Halle, die ARSnova innerhalb ihrer Lehrveranstaltung einsetzen möchten, um eine Rückmeldung über die jeweiligen Veranstaltungsräume an die Fach-AG Vertreter, damit wir den Internetzugang prüfen bzw. wenn nötig und möglich über das ITZ bereitstellen können.
Inhaltliche Vorbereitungen zum Einsatz von ARSnova betreffen das Anlegen von Fragen. Für Nutzer ist es dabei möglich, einzelne oder kursspezifische Sessions, die unter einer ID-Nummer ortsunabhängig abrufbar sind, zu konstruieren und abzuspeichern. Zum Anlegen einer Session steht dem Anwender eine Bandbreite unterschiedlicher Fragetypen zur Verfügung:
- Multiple Choice (MC)
- Single Choice (SC)
- Ja/Nein (J/N)
- Textfragen (Txt)
- Fragetyp mit Likert Scala (Likert)
- Fragetyp mit Bewertung (Note)
Zudem besteht die Möglichkeit Lernkarten (LK) zu integrieren. Lernkartensets werden dabei vom Lehrenden erstellt und den Studierenden als Hilfsmittel zum systematischen Lernen zur Verfügung gestellt. Der Fragetyp Planquadrat (PQ) befindet sich derzeit noch in der Testphase. Die beta-Version ist verfügbar. Planquadrat ermöglicht Bildfragen zu integrieren. Bilder oder auch Fotos können hier über Festplatte oder URL eingebunden werden. Über das Bild werden Planquadrate wie ein quadratisches Raster (maximal 16×16 Planquadrate) gelegt, als Antwort wird ein Planquadrat markiert. Zusätzlich ist es möglich, Formeln im LaTex-Format in die Fragetypen zu integrieren.
Vorbereitete Sessions können zeitunabhängig oder nach Bedarf auch nur für eine bestimmte Zeit/Lehrveranstaltung freigegeben werden. Zum Aufrufen der Session im Netz kann ein in die Präsentation eingebundener QR-Code (Barcode) über einen Beamer an die Wand projiziert werden, den Studierende mit einem Scanner im Smartphone abrufen und sich dann über die Webseite in eine vorbereitete Session anonym einloggen. Alternativ sollte ein Link angegeben werden, da auch internetfähige Endgeräte wie Laptop oder Netbook genutzt werden können. Neben der Beantwortung der Fragen erhalten Studierende die Möglichkeit just-in-time Rückmeldung über instant Feedback (kann folgen, bitte schneller, zu schnell, abgehängt) oder anonyme Zwischen-/Rückfragen über ARSnova zu geben.
Lehrende können den in ARSnova integrierten Presenter nutzen, um sich eine anonyme Statistik der Antworten anzeigen zu lassen. Zudem sind hier das Feedback und anonyme Zwischenfragen ersichtlich. Zur besseren Verfolgung der Auditoriumsmeinung kann zusätzlich ein Widget installiert werden. Hiermit wird Lehrenden das Feedback der Studierenden als Applikation auf dem Bildschirm angezeigt.
Anleitungen stehen Lehrenden und Studierenden im Wiki des @LLZ oder als Downloads zur Verfügung:
- Anmeldung und anlegen einer Session (Dozent Uni Halle)
- Anmeldung und betreten einer Session für Zuhörer/Studierende
- Funktionen des Presenters
- ARSnova-Widget
- Anleitungen Zuhörer mit Ansicht auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets
Möchten Sie testen, wie ARSnova aus Studierendensicht aussieht, können Sie als Gast ohne Benutzerregistrierung folgende Session-ID nutzen 72933030. Speziell für Studierende steht die Session 90036968 zur Verfügung.
Ein genereller Überblick zu ARSnova und Einsatzmöglichkeiten (auch unter den Aspekten Unterstützung diverser Lehr-/Lernszenarien und didaktischer Mehrwert) sowie Workflows zur Nutzung von ARSnova (einschließlich Presenter und Widget) ist auch im Wiki des @LLZ zu finden. Zusätzlich bietet das @LLZ individuelle Beratungen und Schulungen zu ARSnova an. Über Aktualisierungen und die Verfügbarkeit neuer Funktionalitäten von ARSnova werden wir weiter in unseren Blogbeiträgen informieren.
Links