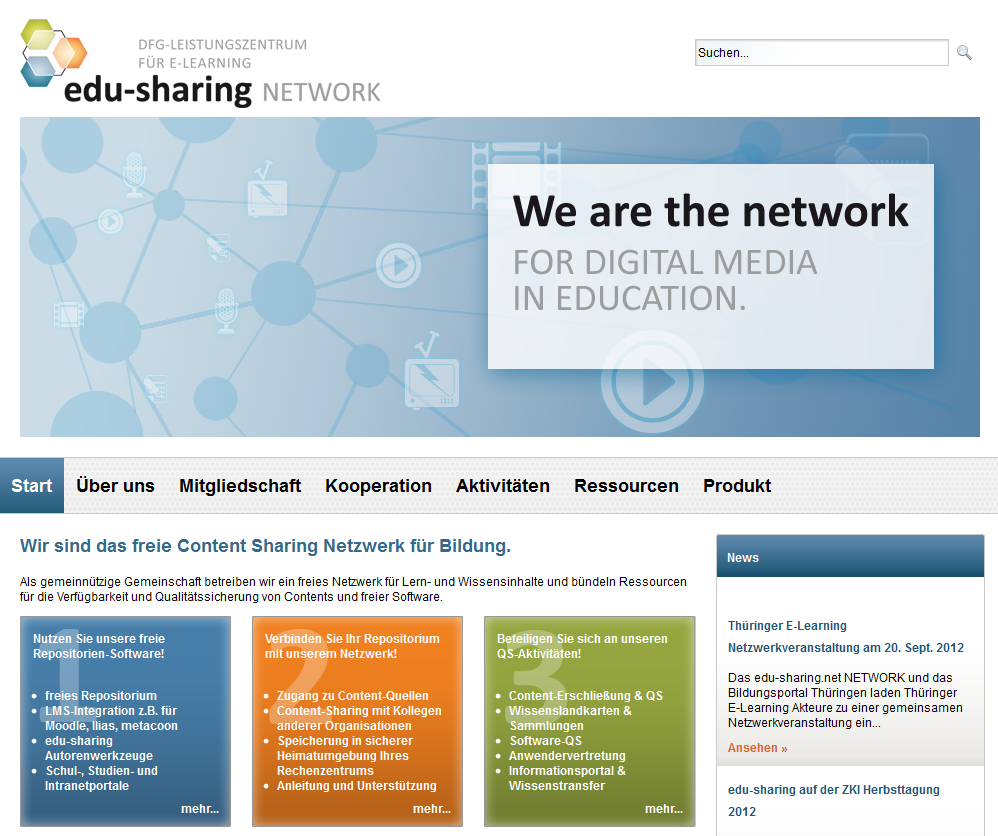Am 22. November 2012 laden wir Akteure und Interessenten des E-Learning zu einer universitätsweiten E-Learning Tagung ein. Gemeinsam mit 80 Lehrenden wollen wir interdisziplinär Ideen entwickeln und Konzepte diskutieren sowie potentielle Projektpartner zusammenbringen. Der Schwerpunkt unserer Tagung für Lehrende liegt auf der Unterstützung bei der Entwicklung und dem Einsatz multimedialer Angebote in Lehr-/Lernprozessen.
- Das @LLZ stellt den Lehrenden der Martin-Luther-Universität das Lehr-/Lernzentrum vor
- E-Learning-Akteure unserer Universität präsentieren ihre Projekte und Erfahrungen bei der Planung, Umsetzung und Nutzung multimedialer Angebote
- Externe Referenten halten Keynotes zu „E-Assessment in Massenstudiengängen“ und „Neuen Medien in der Bildung – Bildung im neuen Medium, Katalysatoren des Lernerfolgs“
- Während der Postersession des @LLZ stellen sich die Fach- und Themenarbeitsgruppen vor und Sie können mit uns im Dialog über spezielle Fragen diskutieren
- E-Learning-Akteure und Interessenten debattieren in einer Podiumsdiskussion zur Thematik: „Zukunftsperspektiven E-Learning an der Martin-Luther-Universität – Mehrwert, Möglichkeiten und Grenzen“. Im Focus stehen zudem die sinnvolle Ausgestaltung der E-Learning-Angebote und ein kompetenter Einsatz der Werkzeuge.
Ergänzend zu den Einladungen erfolgte in der vergangenen Woche eine Türschildaktion, um auf die Tagung aufmerksam zu machen. Um Sie auf unserer Veranstaltung begrüßen zu können ist eine Anmeldung bis 15. November 2012 unter http://www.llz.uni-halle.de/llz12/ möglich. Auf dieser Seite finden Sie gleichzeitig das detaillierte Programm und in Kürze Informationen über die Referenten und Vortragsinhalte.