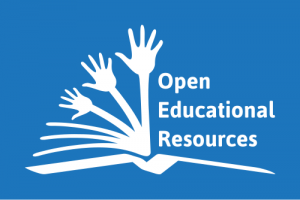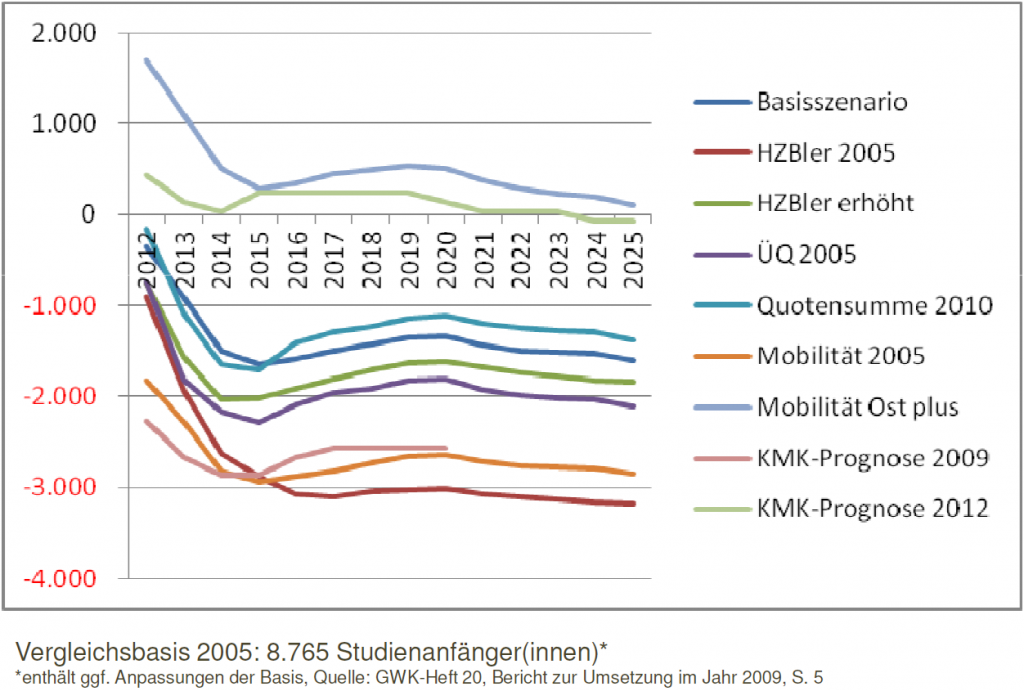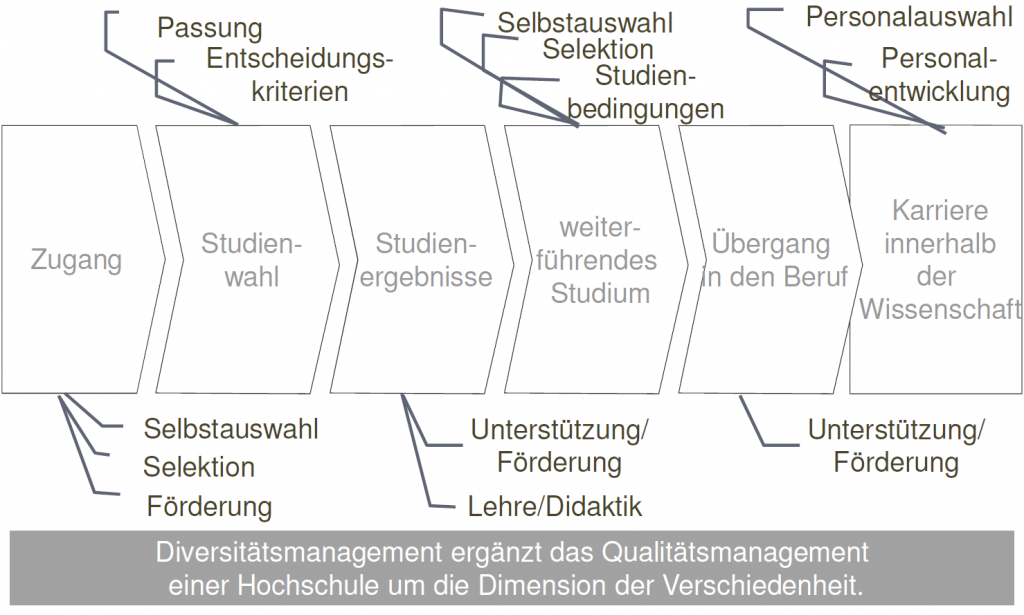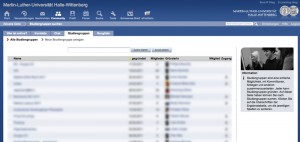Große Tagungen leben von ihrer Vielfalt. Das gilt insbesondere bei neu einzuführenden Themen wie multimediales Lehren und Lernen. Für die erste Tagungsveranstaltung des @LLZ bedeutete dies: Eine große Breite an dargebotenen Referaten auf der einen und viele verschiedene Teilnehmende mit unterschiedlicher fachlicher Herkunft und Vorerfahrungen auf der anderen Seite. Wenn die Unsicherheit über ein vermeintlich wenig bekanntes Themenfeld überwiegt, aber immerhin schon die Neugierde gewonnen hat, ist der erste Schritt getan. Selbstverständlich gibt es in einer solchen Situation neben Zustimmung (und die gab es reichlich) auch Widerspruch. Und mancher zeigte sich enttäuscht, dass diese Tagung nicht grundständig erläutert habe, was E-Learning konkret sei.
Die Tagung war insgesamt ein Erfolg. Nicht nur von der Teilnehmerzahl her, auch der Livestream wurde mit mehr als 300 Zugriffen rege abgefragt. Mancher bedankte sich persönlich per Email, dass er die Tagung von seinem Büro aus verfolgen konnte (wenn auch nur zwischen zwei Seminaren). Tagungen während der Vorlesungszeit sind immer ein Risiko, aber bis März konnten und wollten wir nicht warten.
Universitäten operieren zwar mit Wahrheiten, sichern aber Ausbildung im gesellschaftlichen Kontext. Neben ihren impulsgebenden Potenzialen sind Universitäten oft auch Getriebene. So verstanden stellen sie sich dieser gewaltigen Welle des sich derzeit vollziehenden weltweiten Umbruchs in den sozialen Medien, den damit verbunden Möglichkeiten in Lehre und im Lernen, den Potenzialen tatsächlich möglicher Interaktivität besonders in Bildung und Ausbildung. Das wird noch nicht überall wahrgenommen. Dass sich gerade etwas immens ändert, dies spüren sicherlich alle, auch wenn es bei manchen eher als Unbehagen, als unbekannte Größe mit damit verbundener Unsicherheit, vielleicht sogar als Gefährdung des Bildungssystems einhergeht. Aber sind es nicht auch gewaltige Chancen? Die Wikipedia beispielsweise, noch vor Jahren eher belächelt, hat aktuell 23.700.000 (!) Artikel weltweit (http://stats.wikimedia.org/DE/TablesArticlesTotal.htm). Die entscheidende Frage lautet also eher, wie wir diesen Umbruch gestalten.
Zum Beispiel, wie Lehrende zu den Kompetenzen kommen, die sie für die neuen Lehr- und Lernmethoden benötigen. In der Podiumsdiskussion gab es dazu eine vielleicht irritierende Antwort: „Durch die Lehrenden selbst.“ Denn wenn Kompetenzen problemlösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, die auch eine entsprechende Bereitschaft ihres Einsatzes voraussetzen, dann liegt die Hauptverantwortung zum Erwerb dieser Kompetenzen bei den Lehrenden. Universitäre Einrichtungen wie das LLZ oder ein hochschuldidaktisches Zentrum können diese Kompetenzbildung fördern, etwa durch praxisnahe Schulungen, das Sammeln und Veröffentlichen von Best-Practice-Beispielen, durch gemeinsame Workshops zur Erarbeitung konkreter Umsetzungsszenarien – im Kern aber ist es ein Lernprozess der Anwender (übrigens Lehrender UND Lernender). „Lehren lernen“, vielleicht kommt es darauf wieder verstärkt an.
Zum Glück sind Tagungen immer mehr als nur die Summe ihrer Präsentationen. Sie bieten Raum für Diskussionen und Austausch, sie ermöglichen Rückfragen und legen im Idealfall den Zeigefinger auf Übereinstimmungen, aber auch auf Differenzen. Niemand wird behaupten, dass Veränderungsprozesse einfach sind.
Und so steckt auch das LLZ in einem Lernprozess. Einiges werden wir bei der nächsten Tagung verbessern: Das Zeitmanagement (weniger Beiträge sind vielleicht mehr), die Länge der Pausen (mit mehr Raum für persönlichen Austausch), die Gesamtlänge (17.15 Uhr als Endtermin ist doch etwas zu spät) und die Ausrichtung der Beiträge (Praxis schlägt Theorie).
Noch vor dem Sommer wird es soweit sein.