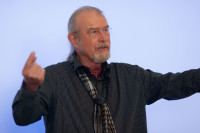Die Lernwerkstatt der Erziehungswissenschaften im Haus 31 in den Franckeschen Stiftungen bietet regelmäßig Werkstattabende an, die für alle Interessierten geöffnet sind.
 An zwei Terminen zum Themenbereich “digital kompetent” waren bzw. sind u.a. auch MitarbeiterInnen des Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (@LLZ) vor Ort vertreten:
An zwei Terminen zum Themenbereich “digital kompetent” waren bzw. sind u.a. auch MitarbeiterInnen des Zentrums für multimediales Lehren und Lernen (@LLZ) vor Ort vertreten:
- 04.11.15 “ “Sicherer durch´s Netz – digital kompetent”
- 18.11.15 “(Freie) Bildungsressourcen verwenden – digital kompetent”
Am Lernwerkstattsabend “Sicherer durch´s Netz – digital kompetent” stand vor allem Datensicherheit im Internet im Mittelpunkt. Zwei Experten des Terminals 21 haben die TeilnehmerInnen des Abends für dieses Thema sensibilisiert, indem sie u. a. die Funktionsweise des Internets und Möglichkeiten zur Datenverschlüsselung im Alltag darstellten. Daneben hat das @LLZ einen Einblick in verschiedene Online-Dienste der MLU gegeben, die mögliche Alternativen zu bekannten Systemen zur Datensynchronisation, Veröffentlichung sowie dem Austausch von Information im Internet bieten können. Dazu gehören z.B. Stud.IP, ILIAS, owncloud oder die WordPress-Blogfarm des ITZ. Außerdem wurde gemeinsam mit den anwesenden Studierenden diskutiert, welche Chancen und Risiken in der Nutzung von Social Media bestehen, welche persönlichen Daten in sozialen Netzwerken gesammelt werden und wie man das selbst beeinflussen kann.
Am kommenden Mittwoch (18.11.15) stehen verstärkt urheberrechtliche Fragen bezüglich der Nutzung von Unterrichtsmaterialien im Fokus. Zum Beispiel: Unter welchen Bedingungen dürfen Materialien aus Büchern und dem Internet kopiert, gescannt, bearbeitet und weitergenutzt werden? Dabei stellt das @LLZ vor, welche Alternativen freie Bildungsressourcen (Open Educational Resources) bieten können und wo man sie finden kann. Geplant ist auch hier wieder eine Mischung aus einem Vortragsteil mit Diskussion und einem Praxisteil, der den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, sich selbst u. a. auf die Suche nach freien Materialien (z.B. Abbildungen) im Internet zu begeben.
Die Lernwerkstattsabende sind offen für Studierende aller Fächer, MitarbeiterInnen, LehrerInnen und andere Interessierte.
Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungsterminen der Lernwerkstatt erfolgt über die Stud.IP-Veranstaltung (siehe Screenshot 1) und den Eintrag in die Gruppe zu dem jeweiligen Termin (siehe Screenshot 2).